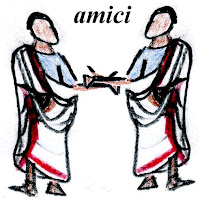|
| "Philosophenschule" (Raffael nachempfunden) |
Blog zu den Historischen Romanen: „AMORES - Die Liebesleiden des jungen Ovid“ und „Rufus“ (Rufus - Donner im Keltenland / Rufus - Catilina und die Jugend Roms / Rufus - Liebe und Leid in Rom / Rufus - Im Schatten des Caesar)
Die „Rufus“-Reihe soll jeder verstehen und genießen können, Jugendliche und Erwachsene, Studierte und Nichtstudierte. Wer sich im Roman auf fremde Welten einlässt, der wird auf unterhaltsame Weise ganz automatisch kennenlernen, was die damalige Zeit so alles zu bieten hatte - und lernt beim Lesen wie von selbst. Alles so authentisch und historisch korrekt wie möglich zu erzählen und dabei spannend zu bleiben, das ist mein Ziel.
Die „AMORES - Die Liebesleiden des jungen Ovid“ sind dagegen nicht immer ganz jugendfrei (wie auch die Originalverse Ovids und seiner Zeitgenossen). Der Laie kann sich über die „moderne“ Sprache & Handlung freuen, der Fachmann über zahlreiche Anspielungen und intertextuelle Scherze.
Auf dem Blog zeige ich einen Blick hinter die Kulissen. Dabei gebe ich auch Hintergrundinformationen über Politik und Alltagsleben der späten Republik und frühen Kaiserzeit in Rom und einiger Kelten- und Germanenstämme.
Feste Probeleser aus verschiedensten Altersgruppen haben bereits die ersten Bände gelesen. Die Rückmeldungen setze ich um. Sehr gute Feedbacks kamen dabei nicht nur von Universitätsprofessoren und anderen Fachleuten sondern gerade auch von Schülerinnen und Schülern - vielleicht demnächst auch von dir? Gerne nehme ich jede gute Anregung auf (Rufus.in.Rom@gmail.com)...
Donnerstag, 30. Januar 2014
Wie lebt man richtig glücklich? Philosophische Schulen der Antike
Donnerstag, 9. Januar 2014
Sokrates- fragen, nerven, bessern
 |
| Der Philosoph Sokrates |
Freitag, 27. Dezember 2013
V. Kleinste Teilchen. Leseprobe aus "Geheimnisse in Rom"
Kapitel V: Kleinste Teilchen
Lucius Sergius Catilina – es würde mich schon sehr wundern, wenn man von ihm noch einmal etwas hören würde.“ Quintus lehnte sich zurück und warf sich genüsslich ein Fischhäppchen in den Mund. „Außer von seinem bevorstehenden Bankrott – vielleicht auch von seinem Rauswurf aus dem Senat, wenn einer der censores sich genauer seine Schulden ansieht, natürlich. Hm!… wirklich gut, diese Häppchen. Wobei Catilinas unsittlicher Lebenslauf allein dafür schon voll und ganz ausreichen sollte… Hm! In der Tat, eine gute Idee, Medea mitzunehmen, sie bringt den Köchen hier immer neue Dinge bei: Bei diesen Pastetchen sieht man kaum noch, dass es Fisch ist - viel raffinierter als an der cratera üblich. Die Köche hier denken wohl, wo der Fisch immer frisch ist, braucht man ihn nicht zu verstecken“.
Dienstag, 17. Dezember 2013
Io Saturnalia – Die Saturnalien
Freitag, 22. November 2013
Philosophie in Athen: Demokratie, Sophisten und die Redekunst
Der historische Hintergrund
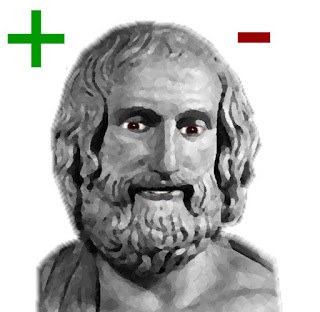 |
| Protagoras: Es gibt immer zwei Seiten |
Sophistik
Donnerstag, 7. November 2013
amicitia – Politik in Rom
Dienstag, 22. Oktober 2013
Die Atomisten – eine Welt aus Legosteinen
 |
| Demokrit - der lachende Philosoph |
Donnerstag, 10. Oktober 2013
Schule und Unterricht im alten Rom
Schule
Unterricht
Man erwirbt Wissen, keine Zeugnisse oder Abschlüsse, deshalb gibt es auch keine Noten. Die „Klassen“ sind klein und im Alter gemischt, wie heute bei einer freiwilligen AG. Schulbeginn ist im Sommer bei Sonnenaufgang, im Winter lange davor und dauert bis zum späten Nachmittag. Reicheren Kindern, die eine öffentliche Schulen besuchen, stellen die Eltern einen Lernbegleiter zur Seite, den paedagogus: Dieser Sklave muss muskulös, kampferfahren und intelligent zugleich sein: Er begleitet die Kinder als Bodyguard auf dem Schulweg, muss ihnen beim Lernen helfen und sie notfalls zur Schule prügeln, wenn sie nicht hin wollen.