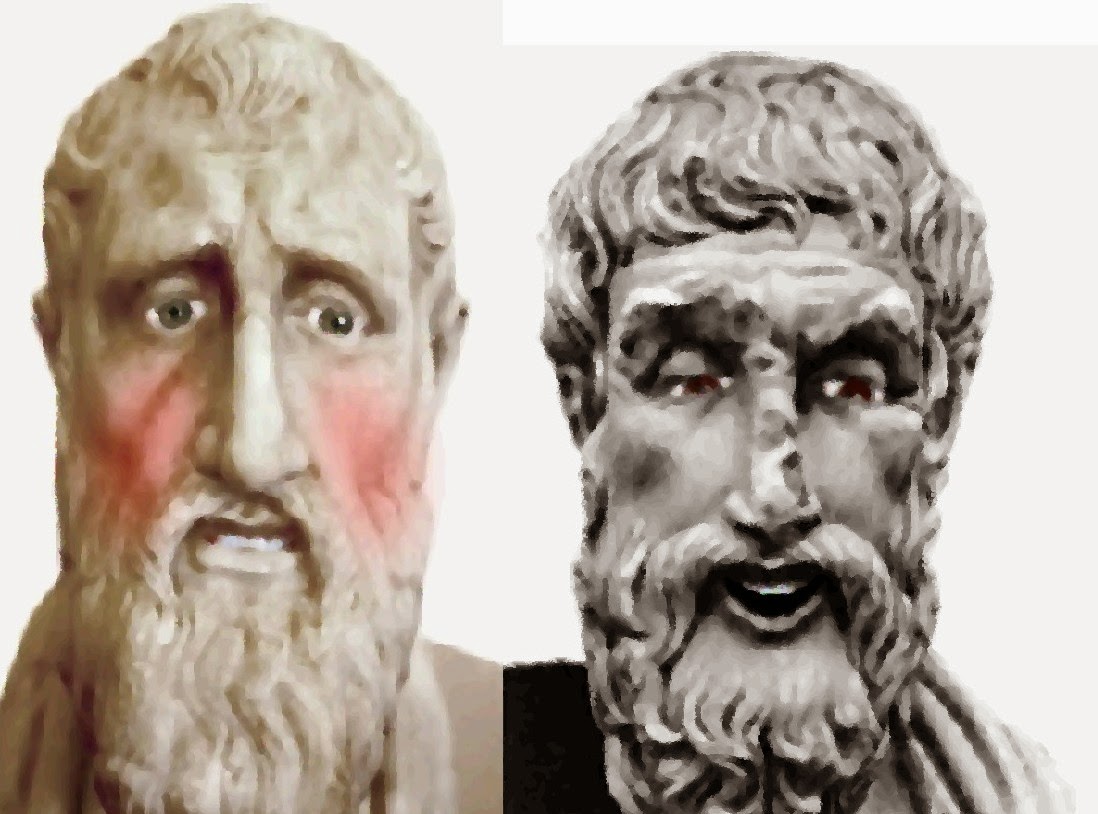Ein Klatschen, ein Spritzen, dann ein erstickter Schrei.
Gaius musste endgültig den Halt verloren haben. Rufus sprang sofort hinterher.
Rufus folgte der Strömung, doch konnte er Gaius in dem schlammigen Wasser und
der absoluten Finsternis nicht finden. Bei allen Muttergottheiten und beim
Apoll der Römer, Gaius hatte doch hoffentlich das Schwimmen nicht vergessen!
„Gaius! Gaius wo bist du?“ Seine Schreie wurden vom Tonnengewölbe der
Kanalisation vielfach gebrochen hin und her geworfen. Keine Antwort. Als das
Echo verklungen war, hört er doch noch etwas: ein panisches Röcheln. „Gaius!
Bleib ruhig! Spuck das Wasser wieder aus. Schwimm einfach auf der Stelle!“ Als
Antwort hörte Rufus nur ein gurgelndes Geräusch, doch das reichte ihm.
Zielsicher packte er zu und zog ihn wieder über Wasser. „Gaius, beruhige dich!“
Rufus legte ihm seinen linken Arm um den Hals und zog ihn rückwärts schwimmend
mit. Gaius prustete und spuckte, schließlich ließ er sich aber von Rufus
führen.
Ein starker Sog zerrte die beiden mit. Die Kanalisation
wurde offenbar laufend mit viel Frischwasser von den Aquädukten versorgt. Orientierungslos
wurden sie im Kanal hin und her geworfen und stießen sich die Köpfe. Dennoch
kämpfte sich Rufus immer wieder an eine Seite und tastete nach Vorsprüngen oder
Planken. Schließlich konnte er sich an etwas festhalten. „Komm jetzt, hoch mit
dir!“ Der Rand war glitschiger als erwartet. Als ihr erster Versuch scheiterte,
begann Gaius wieder hektisch zu strampeln. „Gaius, was soll denn das? Bleib
ruhig!“ „Hier kommen wir nie wieder raus! Entweder ersaufen wir hier unten oder
wir verhungern! So wie der arme Kerl vor uns, dessen hohler Schädel uns
verhöhnt hat... Ai!“ Rufus hatte sich inzwischen auf den Vorsprung schwingen
können und Gaius eine kräftige Ohrfeige verpasst. Das half. Er ließ sich wieder
folgsam mitziehen. „Und nun?“, stieß er zwischen zwei Schluchzern aus. „Kein
Licht! Hier kommen wir nie wieder raus!“
Rufus dachte nach. Abwasser, Strömung… Wir müssen nur dem
Wasser folgen. „Heureka!“, rief er schließlich. „Wasser fließt nur in eine
Richtung: bergab. Also folgen wir einfach der Richtung des Wassers! So kommen
wir zum Tiber.“ „Meinst du denn, wir können so lange schwimmen? So wie es
aussieht, gibt es am Rand meist nur diese verdammt glatten Tunnelwände, beim
Pluto…“ „Keine Sorge, ich kann dich lange genug abschleppen. Solange wir welche
finden, nehmen wir Vorsprünge oder Bretter. Ich tauche mal meinen Fuß rein, um
zu sehen, in welche Richtung wir weiter müssen..., aber he, moment Mal!“ „Was
ist? Warum lachst du?“ „Wir Dummköpfe! Das Wasser ist hier gar nicht so tief,
da kann man stehen!“ „Wirklich?“ Rufus sprang wieder in den Kanal. „Wirklich!
Komm!“
Erschöpft lagen schließlich beide am Tiberufer und
atmeten durch. „Ich hätte wetten können, dass wir in der Cloaca Maxima
rauskommen“, meinte Gaius verwundert. „Umso besser, das Ende der Cloaca Maxima
ist noch nicht überdeckt, ich hätte mich ungern so auf dem Forum gezeigt.“
Dabei hob er seine abwasserdurchtränkten Ärmel in die Höhe. Rufus versuchte
sich zu orientieren. Die Nacht war beinahe vorbei, aber der Tag hatte noch
nicht richtig begonnen. Im Zwielicht konnte er zu ihrer Linken schemenhaft eine
Insel ausmachen. Das musste die Insel des Äskulapius sein, des Sohnes des
Apollo. Gegenüber wimmelte es vor Menschen zwischen all den Kais und den Kränen
der navalia – das mussten die Dockanlagen sein und dahinter die großen
Speicher, wo das Getreide zwischengelagert wurde, das zur Unterstützung ärmerer
Römer verteilt wurde. Kein Wunder, alle Lastkähne von Roms Hafen Ostia
drängelten sich hier wie Ferkel an den Zitzen des Muttertiers. […]
Gerade ging die Sonne hinter dem nächstgelegenen Hügel
auf, an dem er die alte Stadtmauer zu erkennen glaubte. Also lag hinter ihrem
Rücken Osten. Rechts von ihnen breitete sich das Feld am Tiber weiter aus, auf
dem bereits junge Soldaten ihr militärisches Training begannen und waghalsige
Wagenlenker den Staub bis in den Himmel warfen. Dahinter Stadtmauern und
weitere Hügel. „Dann führt ein anderer Kanal vom Esquilin über die Subura zum
Marsfeld?“ Gaius warf sich wieder zurück ins Gras. „Ach wer weiß schon welcher
Kanal wo hin fließt, seit der alte Etruskerkönig die Ebenen Roms entwässert
hat. Das Kanalsystem ist weit verzweigt. So viel ich gesehen habe, gibt es
viele Querverbindungen und Sackgassen. Diesen Ausgang hat vielleicht seit
Tarquinius Priscus niemand mehr zu Gesicht bekommen. Völlig zugewuchert und
fast vollständig unter Wasser. Ein Wunder, das wir da heil durch gekommen sind
– Mercurius sei Dank!“ Rufus rieb sich die Schürfwunden an Armen und Gesicht,
die er sich im Kanal zugezogen hatte. Gaius sah ein wenig peinlich berührt zu
ihm hinüber. „Ach was soll‘s“, grunzte er schließlich, ging zu Rufus hinüber
und packte seinen rechten Arm bis zum Ellenbogen: „Dir gebührt ebenso großer
Dank! Du hast mir das Leben gerettet. Schau mir in die Augen, Rufus, Sohn eines
Adligen aus dem fernen Norden: Jetzt bist du wirklich mein Bruder, nicht nur
irgendein Gastfreund meines Vaters!“ Gerührt verkniff sich Rufus eine Träne. Er
hatte sich schon immer einen großen Bruder gewünscht. Vor allem jetzt, wo seine
große Schwester als Geisel der Sueben in der Ferne weilte. „Bruder.“ „Bruder.“
Feierlich wandten sie sich gen Osten und sahen gemeinsam zu, wie die Sonne über
dem Kapitol aufging. Langsam tauchte sie Tempeldächer und Statuen in eine
rotgoldene Glut, deren Widerschein auf den einzelnen Strahlen bis zu ihnen zu
gleiten schien.