Kapitel VIII: Cicero
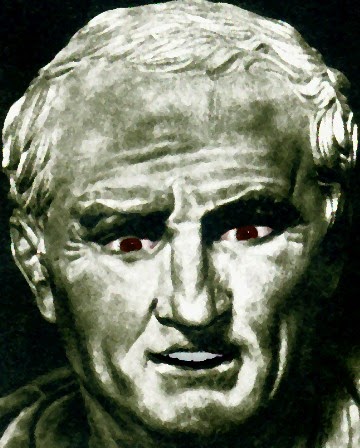 |
| Schwer zu überraschen - Cicero |
[…]
[Rufus erfährt von Gaius über das Menschenbild und Weltbürgertum des
Plautus. Cicero gelingt es, die zerstrittenen Parteien durch eine mitreißende
Rede zu versöhnen. Clodius, Antonius und Gaius schleppen Rufus in eine dunkle
Taverne mit, wo sie auf ihre Weise seinen Geburtstag feiern.]
Am nächsten Morgen war Rufus kaum aus dem Bett zu
bekommen. Ob etwa das Kleinbisschen Wein daran schuld war? Zwar hatte er hin
und wieder am Becher genippt, aber nie viel, immer nur ein Bisschen. Lustig war
es schon gewesen, so mit dem vielen Geld zum Würfelspiel, Wein so viel man
wollte – und für alle Gäste… und war da nicht noch etwas mit Tänzerinnen oder
Akrobatinnen gewesen? Auf jeden Fall hatte das Ganze ausgereicht, auch wenn er
nicht richtig mitgetrunken hatte und immer wieder heimlich etwas weggeschüttet
hatte. Jetzt schienen seine Haare wie winzige Nadeln in seinem Kopf zu stecken,
die Zunge klebte trocken an seinem Gaumen und seine Augen und sein Hals
brannten. Nur gut, dass Gaius heute an einem dies fastus wieder Sura vor
Gericht helfen musste – sonst wären die wohl gar nicht mehr schlafen gegangen.
An der Türe zur Bibliothek fing ihn Apollonius ab: „Der
Herr wünscht dich zu sprechen. Du sollst umgehend zu ihm ins Tablinium kommen.“
„Jetzt? Während das Atrium voller Klienten ist?“ Apollonius schnaubte
verächtlich. „Nein, sofort! Er muss es für wichtig halten, der Herr hat mich
persönlich damit beauftragt, dich zu holen.“ Und als er in Rufus fragendes
Gesicht blickte, fügte er seufzend hinzu: „Vielleicht doch eher eine
Fehleinschätzung. Was für eine Verschwendung meiner wertvollen Arbeitszeit…“
Als Rufus durch das Atrium lief, schmerzte ihn der
Widerschein der Sonne im Impluvium in den Augen. Zu seiner Überraschung war das
Atrium fast leer. Doch war seine Vermutung nicht ganz falsch gewesen, der
Vorraum zum Tablinium war voller Klienten. Nur dass die einfacheren Bürger wohl
schon mit den sportulae-Körben versorgt worden waren. Die Togaträger
hinter der Abtrennung sahen alle sehr gepflegt aus und gingen ihr Anliegen mit
Hilfe ihrer Sklaven und Wachstäfelchen noch einmal durch, bevor sie bis zu
Quintus vorgelassen würden. Dennoch führte ihn Apollonius sogleich hinter den
Paravent und schob ihn ungeachtet der indignierten Blicke der Wartenden direkt
durch die schwere Eichentüre – ohne zu Klopfen. Es war Thrax, der Leibwächter,
der sie von innen wieder schloss und sich dann kaum wahrnehmbar im Halbdunkel
hinter den Regalschränken aufstellte. Von hier hatte er sowohl die Tür zu den
wartenden Klienten als auch die Tür zum Nebenzimmer im Blick. Das
Arbeitszimmer: Es roch nach poliertem Holz, wie die Kassetten der Türe, nach
Leder, nach Pergament, nach Lampenöl und nach Papyrus.
Quintus erhob sich mit einem Ruck von seinem
Schreibtisch. „Salve Quinte!“ begrüßte ihn Rufus schnell. Ältere und ranghöhere
musste man in Rom immer zuerst grüßen, wenn man sie nicht beleidigen wollte –
Quintus hatte ihm aber nicht genügend Zeit gelassen und war noch davor
aufgestanden. „Salve, salve“, murmelte er nur kurz angebunden. Er trat auf
Rufus zu und sah ihm direkt in die Augen: „Was haben die Allobroger und du
getan, dass Cicero euch sehen will?“ „Ci-ce-ro?“, fragte Rufus verdattert. „Ja
Ci-ce-ro. Der Konsul persönlich. Marcus Tullius Cicero. Ich höre?“ „Die
Allobroger und ich? Kei-ne Ah-nung“, stotterte Rufus überrascht, „Crixos, Catugnatos und Ollugnio – habe ich doch seit Tagen nicht mehr gesehen. Sind sie
nicht noch immer außerhalb?“ „Nicht mehr lange, zumindest – schon gestern habe
ich einen Boten geschickt, sie müssten in Kürze hier sein… und du – wo warst du
in letzter Zeit überall? Bist du sicher, dass du nichts Besonderes angestellt
hast?“
Quintus musterte ihn genau. Rufus vermied es, ihm in die
Augen zu schauen. Wusste Quintus bereits, dass er sich in letzter Zeit öfter
mit Gaius herumgetrieben hatte? Aber das machten andere Jugendliche auch, allen
voran Marcus Caelius, Marcus Antonius, Vedius Pollio und sogar der hochadlige
Clodius. „Nein, eigentlich, ich wüsste nicht was“, brachte er mühsam heraus. Ob
Quintus den Besuch bei Catilina meinte? Aber wenn Rufus ihm davon erzählte,
dann wäre zwischen Quintus und Gaius die Hölle los. Nein, das konnte er nicht
riskieren, das seinem neuen Bruder anzutun, selbst wenn Quintus bereits etwas
ahnen sollte. Lieber würde er jede Art von Bestrafung auf sich nehmen. Quintus
kniff die Augenbrauen zusammen: „Du wüsstest nicht was? Und was hat der junge
Schutzbefohlene meines Gastfreundes da in den Haaren?“ Quintus zog ihm ein
Haarband aus dem Schopf. „Ist das etwa von einer… Nein, nicht doch in deinem
Alter – oder doch?“ Oh je, das war ein Stoffband von einer der Tänzerinnen. Wie
war das denn in sein Haar gekommen? „Und da auf deiner Brust – sehe ich da
Weinflecken?“
Bestürzt sah Rufus an sich herunter. Das war ihm beim
schnellen Waschen vorhin gar nicht aufgefallen. Das musste passiert sein, als
er heimlich Wein ausgespuckt hatte. Quintus holte tief Luft, dann setzte er
sich wieder hinter seinen Schreibtisch. Er legte sich die Hände über die Stirn
und seine Kopfhaut. „Hör mal, Rufus, ich bin keineswegs einer dieser alten vertrockneten
Augenbrauenrunzler und Naserümpfer, welche nur die Nobilität achten und alle
anderen verachten - besonders fremde Völker. Ich freue mich auch wirklich, dass
du dich mit meinen Kindern so gut verstehst – neuerdings mit meinem ältesten
Sohn sogar mehr als meine Söhne untereinander. Deswegen musst da aber nicht
gleich seine Gewohnheiten annehmen, das heißt die unrömischen – nun, du weißt
sicher, was ich damit meine…“ Ja, das glaubte er inzwischen zu wissen.
Schuldbewusst sah Rufus zu Boden. So sahen sich die Römer: Selbstbeherrschung
und Pflichterfüllung wie ein Stoiker, ganz im Sinne Zenons. Die Nächte
durchzumachen, hemmungslos zu trinken, zu tanzen und Frauenbekanntschaften zu
machen, das hieß auf Lateinisch dagegen per-graecari – sich wie ein
Grieche benehmen oder »durchzugriechen“.
„Sei‘s drum!“, rief Quintus nach einer Weile. „Wenn du es
auch nicht weißt… vielleicht interessiert sich unser guter Konsul neuerdings
gezielt für den Gallienhandel, wo er doch seine lukrative Provinz an Antonius
Hybrida abtreten will. Oder sind die Allobroger tatsächlich mit ihren Bitten
bis zu ihm durchgedrungen? Will er es tatsächlich riskieren, sich mit den
Steuerpächtern anzulegen, um die Wirtschaftskraft der Allobroger zu retten?
Zuzutrauen wäre es ihm. War das ein Wirbel, als er sich damals um die
Sizilianer gekümmert und ihren Statthalter Verres angeklagt hat…“ Quintus holte
noch einmal Luft, hielt den Kopf schräg und warf einen letzten lauernden Blick
auf Rufus. Doch Rufus hatte noch immer keine Ahnung, was eigentlich los war.
„Hier“, ließ Quintus schließlich ein Bündel Täfelchen über den Tisch rutschen.
Sie waren aus wertvollem lackiertem Holz. Am erbrochenen Siegel glaubte Rufus
eine Kichererbse im Wachs zu erkennen. „Das hat gestern ein Mann bei Cerberus
abgegeben. Reinkommen wollte er nicht. Ungewöhnlich für einen Bediensteten
eines so hohen Beamten. Aber vielleicht hatte er einfach wenig Zeit. So wie ich
auch. Sobald die Allobroger da sind, macht ihr euch auf den Weg. Ist ja gleich
um die Ecke.“
„Marcus Tullius Cicero“, verkündete der Sklave lächelnd,
„wünscht euch tatsächlich zu sehen. Er wird euch in Kürze empfangen, bitte
nehmt Platz.“ Er kritzelte ein paar Zeilen auf ein Wachstäfelchen, dann huschte
er davon. Crixos machte es sich auf einer der Bänke im Atrium gemütlich und
schaute sich stauend um, Catugnatus und Ollugnio blieben jedoch mit vor der
Brust verschränkten Armen stehen. Das Atrium war klein - ungewöhnlich klein für
das Haus eines Politikers, erst recht, wenn man es mit demjenigen der Fabier verglich.
In der Mitte des Impluvium stand eine einfache dorische Säule mit zwei kleinen
Jungen, aus deren Mündern Wasser quoll. Ob der Brunnen wohl von einem eigenen
Wasseranschluss gespeist wurde? Aber wie sollte das Wasser sonst ständig da
hinaus gluckern. Das Plätschern fand Rufus sehr angenehm – er liebte Wasser. Er
bekam Lust, Schwimmen zu gehen - aber im Tiber, da gab es mehr Platz.
„Kaum zu glauben, dass das hier das Haus eines römischen
Konsuls ist!“, meine Crixos und wies auf die spärliche Einrichtung des kleinen
aber makellos gepflegten Atriums: kein Fresko, keine Wandgemälde, nur sauber
verputzte Wände – lediglich ein paar griechische Figuren in den Stuckarbeiten
des Atriums, ein griechischer Stehleuchter aus polierter Bronze und Türen mit
Giebel-Verzierung und roten Vorhängen, die ein griechisches Akanthusmotiv
zierte – Bärenklau. Nur im Vestibulum hatte Rufus beim Hereinkommen ein paar
Rahmen an der Wand gesehen. Es waren aber keine Bilder gewesen, sondern die
üblichen Anschläge der tabulae hospitii: Jeder Gastfreund hatte eine
eigene Tafel, auf der Name und Familie vermerkt waren. Rufus war aufgefallen,
dass besonders viele Griechen dabei gewesen waren, die meisten aus Sizilien -
darunter nannten ihn ganze Städte ihren Gastfreund und Schutzherren: tabulae
patronatūs. Doch Cicero protzte nicht, jedenfalls nicht mit Reichtum. Dafür
war das Atrium geschmackvoll und kostbar genug ausgestattet, dass niemand auf
den Gedanken kommen könnte, er sei arm. Vielleicht wollte Cicero mit seiner
vornehmen Zurückhaltung einen allzu großen Kontrast zu den bescheidenen
Ausmaßen seines Wohnhauses vermeiden. Vielleicht war das aber auch seine
Vorstellung von Stil und Eleganz.
Crixos nahm sich eine handvoll gerösteter Kichererbsen,
die in einer silbernen Schale auf einem Dreifuß bereit lagen. „Bei Esos und
Cernunnos, keiner der einflussreichen Senatoren, die wir bisher aufgesucht
haben, hat so ein kleines Haus! Nicht einmal Troucillos…“ Catugnatos und
Ollugnio schienen sich jedoch überhaupt nicht für Ciceros Wohnsituation zu
interessieren. Sie starrten nur finster in die Ferne. Wenn sie vorhatten, einen
guten Eindruck bei dem führenden Politiker Roms zu machen, um die
Steuererleichterungen für ihr Volk durchzusetzen, konnten sie kein
unpassenderes Gesicht aufsetzen, fand Rufus: „Beim Teutates, wollt ihr etwa
eure Chancen völlig verderben? Ihr wolltet doch aufpassen, niemanden zu
verärgern! Wer wenn nicht ein Konsul könnte eurem Volk noch helfen, die
Zahlungsunfähigkeit abzuwenden?“ Ollugnio grunzte unfreundlich. Catugnatos
versuchte ein Lächeln, was ihm, aber gründlich misslang. „Nun, wir haben schon
ein paar Erfahrungen mit Cicero gemacht.“ „Beim Teutates, das haben wir“, fiel
Ollugnio ein. „Erst verteidigt er das korrupte Schwein von Fonteius und dann…
he, wo willst du hin? Benimm dich hier, beim Taranis!“
Doch Rufus war nicht mehr zu aufzuhalten, er jagte
bereits einem Mann durch die nächstbeste Tür hinterher. Er hatte ihn sofort
erkannt: Es war der kleine Drahtige mit der Narbe. Alleine mit der Kapuze wäre
er schon verdächtig genug gewesen, aber sich einfach an ihnen vorbeidrängen zu
wollen, ohne von einem Sklaven, Liktor, Freund oder Bodyguard Ciceros begleitet
zu werden, das war mehr als auffällig - auch wenn die alle vor der Eingangstüre
und auf dem Dach Wache zu halten schienen. Als sich ihre Blicke gekreuzt
hatten, war sofort Bewegung in den Mann gekommen er hatte einen überraschten
Gesichtsausdruck gezeigt und war errötet, so etwas wie Scham, als ob er sich
bei etwas ertappt fühlte. Rufus musste einfach wissen, warum dieser Mensch ihn
in letzter Zeit ständig zu verfolgen schien. „Bleib stehen! Ich hab dich schon
gesehen!“ Zwecklos. Der Drahtige rannte kreuz und quer durch ein Arbeitszimmer,
stieß eine Statue um, die als Leuchter mit Öllampen behängt war und hastete weiter.
Durch das Triklinium kamen sie wieder durch das Atrium, wobei Rufus die
Kichererbsen vom Dreifuß fegte und Crixos von der Bank fiel.
Schließlich landeten sie in einem großen
lichtdurchfluteten Raum, der vor Schriftrollen überquoll. Der Narbenträger
blieb abrupt in einer verwinkelten Zimmerecke stehen. Rufus lächelte. Jetzt
hatte er ihn! Von hier ging es nicht weiter. Doch als er auf den Mann zuging,
fing dieser an, kühl zu lächeln. Dann zückte er einen Dolch. Rufus lief ein
eisiger Schauer über den Rücken. Die Tür war zu weit weg, um rechtzeitig aus
der Gefahrenzone zu kommen. Wenn er ihm den Rücken zudrehte und losrannte,
hatte der Narbenmann alle Zeit der Welt, ihm den Dolch in den Rücken zu jagen.
Seinen eigenen Dolch hatte er in den Händen von Ciceros Leibwächter lassen
müssen. Einen Augenblick standen sie sich schweigend gegenüber.
Plötzlich hörten sie ein Rascheln und fuhren herum. „Ah
Rufus, vermute ich. Salve!“ Die kraftvolle Stimme gehörte einem anderen Mann,
einem etwas rundlicheren, der hinter einem Regal saß. Er besaß einen dicken
Hals, eine breite hohe Stirn, eine fleischige Nase und sehr markante
Augenbrauen. Als schön würde ihn Rufus nicht bezeichnen, aber es lag eine
unglaubliche Ausstrahlungskraft in seinen Bewegungen: Nur kurz drohte er mit
dem Finger und wie vom Donner gerührt steckte der Drahtige den Dolch weg.
„Marcus, Tiro…“ Der Mann mit der Narbe schlug ehrfürchtig die Augen nieder.
Neben dem Rundlichen stand der nette Sklave, der sie schon im Atrium begrüßt
hatte. Freundlich lächelnd fuhr er mit seinen Notizen fort, ohne aufzusehen.
Zuvor hatte Rufus keinen von beiden bemerkt, schon gar nicht hinter dem Regal.
Als sich nun der Rundlichere erhob, da war es so, als ob es nur noch ihn allein
in diesem Zimmer gäbe und niemanden mehr sonst. Offenbar hatte er hinter ihnen
in seinem Korbsessel in einer Schriftrolle gelesen, die er jetzt wieder
zusammenrollte. „Rufus, du kommst ja schneller als gerufen!“ Darauf ließ er ein
gutmütiges Lachen ertönen. „Gerade wollte ich euch rufen lassen. Nun, das Rufen
ist jetzt nicht mehr nötig, wie wäre es mit dem Vorstellen? Wie es scheint,
kennst du Cicatrix bereits – ein alter … Freund von mir. Tiro, sorgst du bitte
dafür, dass auch die andern Gäste aus dem Norden den Weg zu uns finden?“ […]
[Tiro kehrt mit Catugnatos, Crixus und Ollugnio zurück. Cicero begrüßt
sie zuvorkommend, doch hält er sich auch nicht mit seinen spöttischen
Bemerkungen zurück.]
[…]
Diesmal schafften es die Allobroger nicht, sein Lächeln
zu erwidern. Rufus war verwundert. Quintus Fabius Sanga hielt ihn doch für den
besten Redner Roms! Musste Cicero da nicht ein feineres Gespür an den Tag legen
können? Aber vielleicht war der große Redner gar nicht so groß, wenn er nicht
vorbereitet war? Vielleicht gab er sich nur bei seinen großen Auftritten Mühe
und sprach sonst ganz anders? Cicero setzte eine bekümmerte Miene auf: „Warum
denn so mürrisch? Sicher seid ihr erschöpft von der Reise. Hier in Rom müsst
ihr euch fremd vorkommen, so weit weg von euren Familien und Länderein, Sitten
und Gebräuchen…“ „Da wir uns ja »von den anderen Völkern so sehr an Sitte und
Natur unterscheiden«, meinst du?“ Cicero musste nur kurz überlegen. „Ach, ihr
erinnert euch noch an meine Rede für Fonteius?“, fragte er dann belustigt. „Ja,
das Zitat ist von mir…“ „Siehst du? Wir sind Gallier – wie Du damals deutlich
ausgeführt hast, und unser Mienenspiel jagt Furcht ein. Wir sind nur neugierig,
nicht mürrisch. Vor kurzem schien es noch so, als könnten wir tatsächlich
»leichter die Alpen erklimmen als die paar Stufen zum aerarium«, der
Staatskasse und ihren Pachtverträgen. Oder liegt das daran, dass man uns als
Gallier »weder wegen ihres Jähzorns vertrauen, noch wegen ihrer Untreue
respektieren darf«?“
Für einen kurzen Augenblick erstarb das Lächeln im
Gesicht des Cicero. Doch fast ebenso schnell war es wieder da. „Catugnatos!“,
sagte er in leicht tadelndem Tonfall. „Wer wird denn einem Anwalt die dummen
ungelenken Sprüche vorhalten wollen, der einen Klienten verteidigen muss?“ […].
[Cicero verweist die Allobroger schließlich nach einem
unfreundlicher werdenden Wortgeplänkel an seinen Sekretär weiter, behält Rufus
jedoch zurück]
Rufus […] versuchte Ciceros Blick aus dem Weg zu gehen
und blieb mit den Augen an einer Büste über dem Türsturz hängen: »Epikouros«,
stand darunter auf Griechisch.
„Schön, nicht wahr?“ Cicero war Rufus‘ Blick gefolgt.
„Der war ein Geschenk. Den hat mir Atticus mitgebracht. Titus Pomponius
Atticus: Ein Wohltäter Athens, ein großer Gelehrter und ein hervorragender
Freund. Seine Familie lässt sich bis auf den römischen König Numa Pompilius
zurückverfolgen – dabei ist er gar kein Patrizier, sondern Ritter wie ich.“
„Hat Atticus deine Wohnung eingerichtet? Im »attischen« Stil?“ Cicero musste
lachen. „Nein, so weit geht es dann doch nicht, obwohl wir schon zusammen zur
Schule gegangen sind… Aber ich nutze jede Gelegenheit, um mir gute Stücke
mitbringen zu lassen. Den Zenon da drüben hat mir zum Beispiel mein Bruder
Quintus aus Athen besorgt.“ Cicero wies auf die Büste über der Türe, hinter der
Cicatrix verschwunden war. Rufus entdeckte noch weitere Philosophenköpfe:
Platon, Karneades, Aristoteles. Teils waren sie über echten Türstürzen angebracht,
teils auf Durchgängen, die täuschend echt auf die Wand aufgemalt waren.
„Du magst sehr die griechische Philosophie, oder?“,
fragte Rufus. Cicero zog eine seiner markanten Augenbrauen nach oben.
„Philosophie? Du kannst Philosophenbüsten erkennen? Hätte ich nicht gedacht bei
deiner Her… deinem Herkommen! Bisher bin ich nur einem Gallier begegnet, der
weiß, was Philosophie ist.“ Rufus presste verärgert die Lippen aufeinander.
Cicero war tatsächlich ein Snob! Na dem würde er schon zeigen, was in ihm
steckte: „Ich kann mir sogar vorstellen, dass du mit am meisten den Epikouros
verehrst - nicht wahr? Ist dein Haus deshalb so unscheinbar „einfach“, vor
allem von außen? »Lathe biosas – lebe im Verborgenen«? Oder ist das dein
Bekenntnis zu Zenon und der Stoa, obwohl das Haus eines Politikers schon von
außen Eindruck machen sollte?“
Getroffen. Diesmal konnte Cicero nicht die Haltung
bewahren, sein Gesicht verriet Überraschung. Kurz war er sprachlos, dann
lächelte er freundlich. „Wirklich sehr ungewöhnlich für dein… Alter. Wenn mein
Sohn so gut Bescheid weiß, wenn er einmal so alt ist, bin ich ein zufriedener
Mann. Beim Hercules, nicht einmal mein Augensternchen ist so schlagfertig!“
„Was ist denn nun deine Lebensmaxime, Cicero: lustlose Pflicht oder pflichtlose
Lust?“ Cicero rieb sich amüsiert das Kinn. „Du willst mich also zwischen Stoa
und Gärtchen festnageln? Da wandele ich doch lieber durch den Peripatos und
antworte mit Aristoteles‘ goldener Mitte. Ein Gallier, der es zu Philosophieren
versteht! Von einem Klienten des Diviciacos hätte man das aber erwarten können:
Oh Philosophie, Wegweiserin des Lebens, Erforscherin der Tugend, Vertreiberin
der Laster – was wären wir und das gesamte Leben der Menschen schon ohne dich…?
Auch Druiden brauchen anscheinend Philosophie! Nächstes Mal werde ich Sanga
bitten, mir Diviciacos als Gastfreund zu überlassen.“ „Du bist also ein
Peripatetiker?“ „Gegen Wandelhallen habe ich nichts“, lächelte Cicero, „vor
allem wenn die Sonne zu sehr brennt. Doch liegt mir die platonische Skepsis im
Allgemeinen näher“.
„Und warum steht der Epikouros gleich über dem Eingang
zur Bibliothek?“ „Weil Atticus ihn mir geschenkt hat, natürlich! Jeder guter
Römer ist immer auch ein Mann des Staates und kennt die Pflicht des Zenon.
Außerdem ist mir das starre System des Epikur viel zu dogmatisch, das ist
nichts für einen Skeptiker.“ „Als Skeptiker müsste dir doch der
Kontingenz-Gedanke gefallen - dass alles vom blinden Zufall regiert wird und
so. Götter, die aus Atomen bestehen und nicht in das Schicksal der Menschen
eingreifen…“ „Beim Herkules! Kannst du dir etwa vorstellen, dass ein komplexer
Kosmos ohne ein höheres, ein metaphysisches Gestaltungsprinzip, ja um nicht zu
sagen ein göttliches, entstehen kann? Ich jedenfalls nicht!“ „Aber das stille
Glück in der Familie, ist dir das nicht wichtig?“ „Nicht wichtig!“, tönte
Cicero, „Nicht wichtig! Wie könnte mir meine Familie nicht wichtig sein? Auch
ich habe Kinder. Aber ein Glück, das man nur für sich selbst sucht, ohne
Verantwortung für das Staatswesen, kann so etwas denn für einen Römer jemals zu
akzeptieren sein?“
Rufus überlegte einen Augenblick. „Weil du Römer bist
oder weil du Politiker bist?“ Cicero verzog das Gesicht. „Jeder Römer ist auch
Staatsmann - jeder auf seine Weise, auch diejenigen ohne Amt. Aber was Epikur
da fordert, die völlige Vermeidung von Schmerz und Unlust, das ist mit den
mores maiorum nicht vereinbar. virtus, pietas, labor in negotiis, fortitudo
in periculis, industria in agendo, temperantia, fides – Mannhaftigkeit, das
rechte Verhalten gegenüber Göttern und Menschen, Mühen und Leiden in der
Pflichterfüllung, Tapferkeit im Angesicht der Gefahr, Leistungsbereitschaft
beim Handeln, Treue – all das macht doch einen vir vere Romanus, einen
richtigen Römer erst aus! Wo wären wir denn ohne selbstlose Opferbereitschaft?
Von manchen verlangt das Schicksal, eine Verpflichtung einzugehen, für die
Gemeinschaft ein freiwilliges Opfer zu bringen – und wenn es bedeutet, sich
foltern zu lassen oder gar sein Leben zu geben - glaubst du nicht?“ Rufus
dachte nach. Hätten die Geiseln seines Stammes und deren Angehörigen sich nicht
gebeugt, hätten die Sueben des Ariovistos ein Blutbad unter den Ubiern
angerichtet. „Doch“, nickte er zaghaft. „Gut. Aber Folter und Tod – das kann
nun einmal keine Lust erzeugen, sind wir uns da einig? Gut, das wäre nach
epikureischer Lehre also sinnlos. Wie kann aber ein Staat bestehen, wenn sich
niemand für die Verteidigung der Gemeinschaft einsetzt und sich notfalls opfern
lässt? Und wie kann man in Ruhe sein Leben genießen, wenn es keinen Staat gibt?“
Rufus kratzte sich nachdenklich am Kopf. Schon machte
sich ein triumphierendes Lächeln in Ciceros Gesicht breit. „Wenn ich dich noch
eine Sache dazu fragen darf, Konsul…“ „Nur zu!“ „Nun, Cicero, kommt es nicht
vielmehr darauf an, wie man »Lust« definiert?“ Cicero runzelte die Stirn. „Wie
meinst du das? Ist dir der Bedeutungsinhalt dieses Wortes nicht ganz klar?“
„Nein, das ist es nicht. Ich kenne inzwischen das Wort recht gut, im
Griechischen wie im Lateinischen. Aber überlege doch einmal: Wenn man sich freiwillig
um eines höheren Gutes willen opfert oder Unannehmlichkeiten in Kauf nimmt –
dann hat man doch die freie Wahl, dies auch zu lassen, oder etwa nicht?“ Cicero
schürzte die Lippen. „Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, junger Gallier“.
„Wenn das Motiv für die Entscheidung, die nach Epikur ja eine freie ist, eine
gute Erklärung hat - ich meine, um ein Opfer zu bringen. Stell dir vor, man
entscheidet sich dafür, ein Opfer zu bringen und man erfährt gerade deswegen
»Lust«. Ich meine eine andere Art von Lust, Lust, weil man zufrieden damit ist,
seine Entscheidung durchgehalten zu haben – weil man ein Opfer bringt und stolz
darauf sein kann. In dem Fall müsste man sogar unzufrieden sein, also »Unlust«
erfahren, wenn man die Unannehmlichkeiten vermeidet, die man als Preis zu
zahlen hat, wenn man seiner Überzeugung folgt: Seinem Stamm zu helfen, die
Freiheit zu verteidigen, oder sonst einem höheren Ziel zu nützten – dafür zu
leiden, das kann einen doch auch glücklich machen – oder dich etwa nicht?“
Cicero zog beide Augenbrauen nach oben. „Was für ein
unorthodoxer Ansatz… ich glaube jedoch kaum, dass Epikur das auch so gemeint
hätte. Seine Philosophie birgt allerdings noch mehr Schwachpunkte.“ „Welche
denn?“ „Na denk einfach einmal an das Atommodell Epikurs mit der παρέγκλισις
oder declinatio, wenn du so willst: der spontanen Abweichung der Atome
in ihrer Fallrichtung“ Rufus dachte angestrengt nach. Wie war das noch einmal,
wuselten die nicht schräg durcheinander? Aber nein, bei Demokritos kamen sie
alle parallel… „Du glaubst an das Modell des Demokritos?“ „Immerhin ist es in
sich logisch. Epikurs Lehre ist außerdem nicht einmal eine große gedankliche
Eigenleistung, sie ist unselbständig und beruht auf Demokritos: Aufgrund der
Unwissenheit leben wir in Schrecken und Furcht, durch die Kenntnis der
Naturgesetze aber werden wir vom Aberglauben befreit, die Furcht vor dem Tod
wird uns genommen, wir werden nicht mehr verwirrt. Rationales Denken und
Urteilen ist nur mit genauer Kenntnis des Wesens aller Erscheinungen möglich,
ansonsten werden unsere Sinne beim Urteilen verwirrt. Dass ist doch eigentlich
alles nur Demokritos. Da wo Epikur dann aber selbst den Gedanken der Atomlehre
weiterentwickelt, da verschlechtert er ihn, anstatt ihn zu verbessern: Seine
Neuerung mit der παρέγκλισις bleibt gänzlich ohne rationale Erklärung und macht
die gesamte Idee unsinnig“.
„Hm“, machte Rufus, „wenn man bei Demokritos stehen
bleibt, bleibt dann nicht das Problem, dass die Atome, die alle in dieselbe
Richtung von oben nach unten fallen, sich dabei eigentlich gar nicht berühren
können? Wie können die Atome da zusammenstoßen, neue Verbindungen eingehen,
sich zusammenschließen und sich wieder trennen? Müsstest du dann nicht auch
Demokritos kritisieren und auch die gesamte Atomlehre ablehnen?“ Cicero machte
kurz ein überraschtes Gesicht. „Hm“, räusperte er sich schnell, „jedenfalls
fehlt in Epikurs System die gestaltende Kraft – die Entstehung komplexer Körper
durch das Zufallsprinzip – das scheint mir jedenfalls äußerst unlogisch zu
sein. Auch die Wahrnehmungs-Lehre von den eidola muss man einfach ablehnen,
wenn man es genau bedenkt.“
Rufus musste an Fabia denken und wie erbost sie reagiert
hatte, als ihr Crispus die Philosophie solcher Denker nahe gebracht hatte:
Philosophen, welche die Welt rein rational ohne die Götter zu erklären
versuchten. Für Rufus war es anfangs auch schwer vorstellbar gewesen, dass
Götter nichts auf Erden bewirken konnten oder dass es sie vielleicht überhaupt
nicht gab. Doch hatte er sich unter Crispus‘ Erklärungen der Philosophen
langsam an den Gedanken gewöhnt. An Epikouros kritisierte Cicero vorgeblich das
Fehlen einer rationalen Erklärung der spontanen Abweichung der Atome in ihrer
Bewegungsrichtung. Doch störte ihn nicht vielmehr etwas ganz anderes?
„Sag einmal Cicero, kann es sein, dass dir bei Epikouros
nur eine Art göttlicher Willen fehlt – so einen, wie man ihn noch bei Zenon und
Platon findet? Wenn sich komplexe Organismen durch Zufallsprinzip entwickeln,
dann soll für dich zumindest der Willen eines Gottes oder wenigstens
irgendeines höheren Wesens im Spiel sein?“ Cicero machte ein ärgerliches
Gesicht und zog seine buschigen Augenbrauen zusammen. „Beim Hercules!“ Doch
schnell fasste er sich wieder und lächelte: „Sag einmal Rufus, wie heißt eurer
Hauslehrer noch gleich? Ich könnte mir gut vorstellen, ihn später für meinen
kleinen Marcus zu engagieren, wenn nicht für Tulliola… Ich danke dir für die
Anregungen! Das ist ein interessantes Thema, spannend genug, es einmal in einem
platonischen Dialog etwas genauer zu erörtern. Wenn man nur genügend Zeit und
Muße dafür hätte, aber als Konsul…“
„Marcus! Was schwatzt du denn da so lange? Du weißt doch,
wie wenig Zeit wir zu verlieren haben!“ Mit einem Mal war ein kräftiger Mann
ins Zimmer gestürmt. Die Ähnlichkeit mit Cicero war verblüffend. Nur dass
dieser Mann eindeutig mehr Sport trieb und einen stärkeren Unterkiefer besaß.
So könnte Cicero wohl aussehen, wenn er mehr trainieren würde – viel mehr. „Na,
was ist, Bruder? Hat er dir schon alles erzählt, was du wissen willst?“ Die
sportliche Variante von Cicero gefiel Rufus viel weniger: seine Augen blitzten
unfreundlich und selbst seine Stimme hatte etwas Harsches. Außerdem hatte er
ein paar Dolchträger mitgebracht, die sich breitbeinig vor den Türen aufbauten.
Der Sportliche schnippte ihnen mit den Fingern zu: „Wenn nicht – auch gut: Dann
prügeln wir’s doch einfach aus ihm raus!“ Gleichzeitig schlossen sich alle
Türen der Bibliothek. Selbst die hohen Fenster waren verriegelt. Nur noch die
Öllämpchen spendeten ein unruhig flackerndes Licht. Mit einem finsteren Lächeln
kam der Mann näher und zog einen Dolch. Rufus schluckte.
[…]
[Cicero gelingt es, seinen Bruder Quintus zu beschwichtigen. Doch
verlangt er einen hohen Preis, als er Rufus fragt, ob er ein Geheimnis bewahren
kann…]
Eine kühle Brise wehte vom Tiber zum Esquilin und strich
sanft über den Garten. Bäume und Büsche raschelten leise. Außer dem fahlen
Mondenschein und dem gedämpften Sternenlicht wiesen punische Laternen aus
farbigem Glas den Weg aus dem Garten und zur Balustrade des ersten Stocks, wo
die Schlafzimmer lagen. Ab und zu wehten ein paar Geräuschfetzen aus dem Tal
mit nach oben -Gebell, Gelächter oder Gezeter-, ebenso Gerüche - Dampf aus der
Subura. Sonst war es still. Im Hause des Quintus Fabius Sanga waren bereits
alle schlafen gegangen. Alle bis auf Rufus - zumindest im hinteren Teil des
Hauses. Rufus hatte sich zuerst an seinen Hund gekuschelt und wäre gerne dort
im Vestibulum geblieben, doch nach ein paar Streicheleinheiten mit Milmass
hatte ihn Cerberus wieder Schlafen geschickt: Offenbar ziemte es sich nicht,
dass ein Gast der Fabier im Eingangsbereich herumlungerte. Schlafen, als ob das
so einfach wäre!
Rufus musste an zu Hause denken, seine Familie und seine
Freunde. Er konnte sie einfach nicht vergessen: auch wenn die Erinnerungen
längst nicht mehr so stark waren, sie wollten einfach nicht verblassen. Am
Abend hatte er immer wieder die Briefe des Suarto gelesen und dabei die Tränen
unterdrückt – wenn nur dieses blöde Heimweh nicht wäre! Schlecht waren die
Nachrichten keineswegs. Nur fand er es schwierig, sie zwischen den Zeilen zu
erkennen. Suarto hatte nicht ganz offen schreiben können, für den Fall, dass
seine Briefe in falsche Hände geraten sollten – in die des Dumnorix oder gar
des Ariovistos. Waren Haeduer, Averner und Sequaner schon so weit, ihre
Dauerfehde zu begraben und sich gemeinsam von der Herrschaft des suebischen
Heerkönigs zu befreien? Wer würde noch alles bei dieser Koalition der Gallier
mitmachen? Die Chatten vielleicht, die Ubier sicher, sobald sie davon erführen
- oder etwa doch nicht? War die Sicherheit der Geiseln in den Händen des
Ariovistos mehr wert? Würde man die Geiseln verraten, wenn man sich gegen die
Sueben erhob und ihr Leben aufs Spiel setzte? Wie viel war ein Menschenleben
wert und wie viel die Sache, um derentwillen man es aufs Spiel setzen sollte?
Wann durfte oder musste man einen geliebten Menschen verraten und wann auf gar
keinen Fall?
Veleda, dachte er. Veleda, seine ältere Schwester hätte
sicher Rat gewusst. Sie war die einzige, mit der er über solche Fragen redete –
oder wenn er nicht weiter wusste – oder überhaupt... Nur war Veleda eine Geisel
des Ariovistos und weit entfernt. Bei dem Gedanken daran musste er seufzen. Sie
war so weit von ihm entfernt wie die Sterne am Himmel. Es war bei ihnen wie mit
Veleda: Er wusste, dass sie da waren, aber hier in Rom verbargen sich die
meisten von ihnen zuallermeist hinter einer dicken Dunstwolke. So hell und klar
wie zu Hause leuchteten sie hier nie. Dennoch lag er mit hinter dem Kopf
verschränkten Armen im Gras und starrte in den Nachthimmel. Gerade jetzt konnte
er doppelt Rat gebrauchen. Was sollte er nur tun? Cicero hatte ernsthaft
besorgt gewirkt, aber konnte man ihm trauen? Würde Catilina wirklich ganz
Italien in Tod und Verwüstung stürzen? Quintus und Larcia schienen davon
überzeugt. Quintus schuldete er Loyalität, schließlich ließ er ihn hier wohnen,
zahlte für sein Essen und seine Ausbildung. Hier war er vor Dumnorix sicher und
konnte auf die Briefe von Suarto warten, bis es so weit war, dass er seinem
Stamm helfen konnte. Aber war er nicht auch Gaius verpflichtet? Was wenn Gaius
recht hatte und Cicero wirklich nur übertrieb? Wenn Catilina nur dem Volk
helfen wollte? Dann würde er alles zerstören, wenn er für Cicero spionierte.
Anderenfalls würde er mithelfen, ein Blutbad anzurichten, sollten Cicero und
Quintus recht haben und Catilina nur nach eigener Macht streben. Dann musste er
Catilina verraten, der ihn so freundlich beschenkt hatte – und Gaius, seinen
gerade erst gewonnenen Bruder. Ein tiefer Seufzer entrann seiner Brust.
„Da bist du! Warum versteckst du dich hier?“, flüsterte
es durch die Rosenhecke. Rufus setzte sich mit einem Ruck auf. „Fabia?“ Fabia
lächelte. „Pst, nicht so laut! Wenn man sich versteckt, dann sollte man nicht
einmal seufzen. Sonst wird man gefunden, weißt du?“ „Ich wollte Lucius nicht
stören. Ich wäre ja auch drüben auf die kleine Dachterrasse gegangen, aber da
oben hätte ich sicher im Vorbeigehen die Sklaven aufgeweckt. Die Holzdielen
knarzen.“ „Verstehe. Manchmal hat da oben auch Aulus Wachdienst. Früher ist
Gaius ein paar Mal erwischt worden, als wir noch kleiner waren.“ Fabia ließ
sich eng neben Rufus im Gebüsch nieder. Aber warum bist du überhaupt auf?“
Fabia legte ihren Arm um seine Schulter: „Musstest du etwa an jemanden
Bestimmtes denken?“ Mit der freien Hand strich sie sich durch ihre langen
braunen Haare.
„Nein“, winkte Rufus ab. Er lehnte sich wieder zurück und
sah wieder gen Himmel. „An die Sterne. Und ob sie mir etwas raten wollen. Aber
was machst du eigentlich hier? Sollte nicht Agatha bei euch vor der Türe
schlafen und auf euch aufpassen?“ „Agatha – passt auf, ich glaube man kann ihr
Schnarchen noch von hier unten hören.“ Fabia kicherte. „Schön hier, so halb verdeckt
vom Blätterdach… Erzähle mir von deinen Sternen. Tragen sie in eurer Heimat
auch die Namen von Helden, Göttern und Liebespaaren?“ Fabia schmiegte sich an
ihn. Rufus ließ es sich gefallen. „Auch unsere Sterne erzählen Geschichten.
Eure Sternbilder sind aber ein wenig anders. Im Moment wollen sie mir einfach
nichts sagen.“ „Schade, dabei ist doch da drüben eine große Lücke in den
Wolken… Du willst Geschichten hören? Dann frage mich doch. Ich kenne nicht alle
griechischen Mythen so gut wie Fabiulla, dafür bin ich besser bei unseren
römischen. Unsere Mythen helfen uns dabei, zu wissen, wer wir sind und was wir
tun müssen.“ Rufus starrte weiter in den Nachthimmel. Er versuchte ein
bekanntes Bild zu erkennen, doch nichts schien sich zusammenzufügen. Der Himmel
wollte ihm anscheinend kein Zeichen schicken.
„Wie wäre es mit einer Geschichte über eine schwere
Entscheidung?“, flüsterte er schließlich. […]
[Fabia erzählt Rufus von Dido und Aenaeas]
„Und die Entscheidung?“ Fabia setzte sich ruckartig auf
und blickte Rufus herausfordernd in die Augen. „Ja Rufus, die Entscheidung: Was
rätst du einer Frau, die von höherem Rang ist? Soll sie einem Fremdling ihre
Liebe gestehen? Auch wenn es gegen das Herkommen ist und gegen ihre Pflicht,
gegen die Traditionen ihres Volkes, gegen die Sitte der Vorväter?“ Rufus sah
sie nur verständnislos an. „So eine Entscheidung habe ich nicht gemeint“,
murmelte er schließlich. „Woher soll ich denn wissen, was eine Frau soll?“
Fabia wandte schnell ihr Gesicht ab. „Ist etwas mit dir? Hast du etwas im
Auge?“ „Nein, nichts. Ich muss wieder hoch. Nicht dass Agatha vorher aufwacht.“
Damit schlich sie wieder davon. Rufus blieb im Gras liegen. Er konnte sich
keinen Reim darauf machen, was Fabia ihm hatte sagen wollen. »Aber wer kann
schon die Frauen verstehen« – hatte jedenfalls Onkel Lellavo immer gesagt. Die
Sterne traten jetzt klarer hervor. Vielleicht wollten sie ihm jetzt endlich
etwas sagen. Genügend Geschichten schienen sie ja erzählen zu können. Konnten
sie ihm auch helfen, die richtige Entscheidung zu treffen?
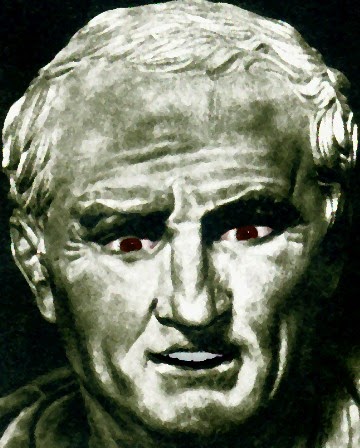
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.